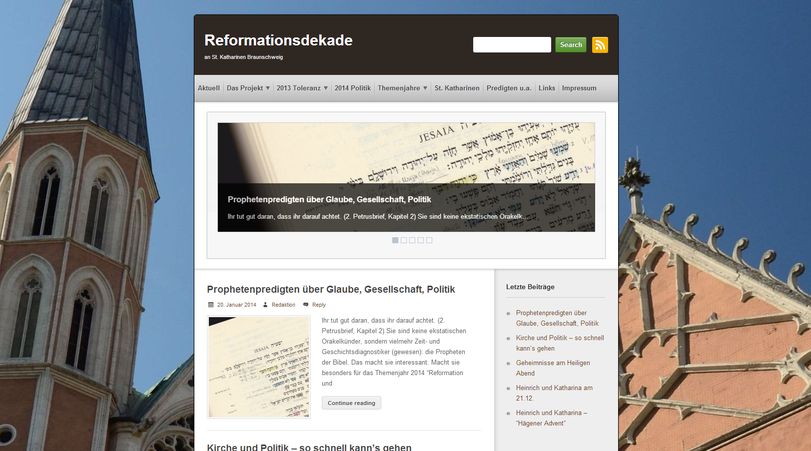„Es ist vielleicht eine der besten Reden, die am Festtag von 500 Jahren Reformation in unserem Land gehalten wurden“, würdigt Katharinenpfarrer Werner Busch die Ansprache von Erik Flügge am 31. Oktober 2017 in Gießen. Frisch und herausfordernd. Wert, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Der Theologe wendet sich in einem Brief an den politischen Strategen und Kommunikationsberater.
„Es ist vielleicht eine der besten Reden, die am Festtag von 500 Jahren Reformation in unserem Land gehalten wurden“, würdigt Katharinenpfarrer Werner Busch die Ansprache von Erik Flügge am 31. Oktober 2017 in Gießen. Frisch und herausfordernd. Wert, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Der Theologe wendet sich in einem Brief an den politischen Strategen und Kommunikationsberater.
Lieber Herr Flügge!
Sie benennen in Ihrer Rede sensible Problemzonen der Kirche. Obwohl – oder gerade weil Sie ihr wohlwollender Teilnehmer und Liebhaber sind, klingt Ihre Rede wie von einem frischen Außen in ein miefiges Innen gesprochen. Dabei bleiben Sie nicht im Problematisieren hängen, sondern fordern für die kirchliche Rede einen neuen Ton, den Sie auch selbst glaubhaft anstimmen. Das lässt aufmerken. Es fordert mich als Prediger positiv heraus, mehr als manche akademische Predigtlehre es schafft. Deshalb lese ich Ihre Rede gerne, auch mehr als einmal, denn sie gibt mir zu denken. Es ist vielleicht eine der besten Reden, die am Festtag von 500 Jahren Reformation in unserem Land gehalten wurden.
Gut gebrüllt! Allerdings – in meinen Ohren – doch nicht so eindeutig, wie Sie es selbst fordern. Im Lauf Ihrer Rede verschieben Sie die Koordinaten. Aus den in ihrem wuchtigen Format zugleich selbstwidersprüchlichen, zerrissenen und in ihrem trotzigen Mut auch ängstlich getriebenen Reformatoren machen Sie unversehens „das [schlichte] souveräne Ich“. Die Dramatik und Tiefe dieser aufgewühlten und aufgeblühten Existenzen schnurrt plötzlich auf diesen Begriff zusammen wie ein Gummi, das seine Spannkraft verliert. Damit verändern Sie das (Menschen-)Bild, das Sie passagenweise doch so mitreißend komplex beschreiben konnten. Sie vereinfachen. Funktionsweise und Aufmerksamkeitslogik in unseren Massenmedien hin oder her: Der Begriff, auf den Sie es bringen, kommt einer Wurzelspitzenresektion gleich. Nerv raus. Entzündung weg. In der Tiefe gekürzt. Hält.
Es ist dann schlüssig, dass Sie den Begriff des souveränen Ich auch in der rechtspopulistischen Agitation repräsentiert sehen. Natürlich pervertiert, nach dem Motto: Vorzeichen falsch, Methode richtig. Die Frankfurter Buchmesse hat jüngst gezeigt, wie anders und befremdlich diese Art der Auseinandersetzung in einem sonst so feuilletonmäßig gedämpften hochkulturellen Milieu wirkt. Und wie wenig gerüstet man dort im Buchwesen – auch hier in der Kirche – ist, um dem zu adäquat begegnen.
Mit dem Blick auf den Rechtspopulismus geben Sie Ihrem Gedankenweg eine Wende, bei der ich nur sehr zögernd mitgehe. Nicht nur weil AfD-Bashing – das ja im Hintergrund steht und ohne das diese Passagen nicht funktionieren würden – inzwischen langweilig ist (ich genieße die Aufregungs-Pause in den öffentlichen Debatten, die die Sondierungsgespräche derzeit bedeuten, und erhole mich etwas von der Wahlkampf- und Wahlabendhysterie). Geschenkt. Sondern weil Sie in diesem Zusammenhang mit dem Begriff des souveränen Ich meinem Dasein als predigender Mensch etwas wegnehmen. Dieses Menschenbild schneidet ein Stück Wirklichkeit von mir als Prediger ab, das ich zwar manchmal auch selber gerne los wäre aber nie loswerde: den Selbstzweifel, die Furcht, den inneren Konflikt, das Unterlegensein. Damit kokettiere ich hier nicht. Avantgarde liegt mir fern. Es ist schlicht kräftezehrend und nicht wegzukriegen. „Die Reformation ist Freiheit von Angst“, sagen Sie. Gut, dass sich Ihre Rede nicht auf diesen falschen Satz reduzieren lässt. Aber sie läuft auf ihn zu. Ich komme darauf zurück.
In der kirchlichen Kommunikation von heute ist eine Art ummäntelter Zurückhaltung und ganz sicher auch eine fette Portion Menschenscheu zu beobachten, darin stimme ich mit Ihnen überein. Nicht überall, aber oft ist es Sprache mit angezogener Handbremse, um bloß in der Tempo-30-Zone nicht unangenehm aufzufallen. In den Beispielen der Verflachung, die Sie genüsslich aufspießen und ganz zu Recht als unglaubwürdig entlarven, sehe ich allerdings vielmehr eine inszenierte Furchtlosigkeit. Und DIE kann einem Angst machen. Denn so vierliert man die Erdung verlieren. Versprochene Furchtlosigkeit ist Verführung zum Realitätsverlust. Diese vielbeklagte Belanglosigkeit (von mir aus auch „Korrektheit“) kirchlicher Rede klingt in meinen Ohren – wo sie stattfindet – wie das Pfeifen im dunklen Keller. In diesem Kommunikationsstil liegt ein schwerer Irrtum vor, der weltanschauliche, religiöse Relevanz hat. In diesem Irrtum sind Sie sich mit den von Ihnen kritisierten Kirchenrednern vielleicht sogar unfreiwillig einig; nur die Dialekte, in denen man darüber redet, sind eben unterschiedlich. Der Irrtum heißt – bereits erwähnt – „Freiheit von Angst“. Die gibt es leider nicht. Für keine und für keinen von uns, so lutherisch jemand auch werden mag. Wir bräuchten sonst die Psalmen nicht. Die Reformation ist Trost. Sie ist Verbindung von Wunden. Sie ist auch Trotz. Aufgerichtet werden der Gebeugten. Sie ist ein Freiwerden, aber noch kein Freisein. „Freiheit von Angst“ klingt viel zu sehr nach Abwesenheit von Beunruhigung, klingt nach Psychopharmaka. Nach dem Opium, das das Volk – angeblich – so liebt. Das Gegenteil davon, die Zuversicht, ist kein Guthaben in der Seele, das man durch Glaubens- oder Kirchenzugehörigkeit schon überwiesen bekommen hätte. Im Lebensprozess ringt Gottes Geistmacht stets mit den destruktiven Tendenzen und Kräften dieser Welt. Unsere Seele ist und bleibt die Arena dieses Kampfes, die bis ins Zwischenmenschliche und Politische hinausreicht. Das Evangelium – oder besser: der, von dem es erzählt – steht uns in diesem Kampf bei. „Fragst du, wer der ist. Er heißt Jesus Christ.“ (EG 362) Das ist Reformation. Weil wir nur das Wort haben, das von ihm redet bzw. sich auf ihn beruft und auf das hin etwas gewagt sein will, ist Reformation immer auch Wagemut. So tun, als wäre das, wofür Er (aufer)stand, jetzt da. Und verwegen hoffen, dass Er es für uns einlöst.
Aber nun sind die Populisten wiedergekommen. In ihrer echten Angst oder gespielten Besorgtheit tragen sie kein fröhliches Pfeiflied mehr auf ihren Lippen. Solche Beruhigungs-Kommunikation beschimpfen sie vielmehr als Lüge. Und sie werden laut dabei. Martialisch, archaisch, wuchtig treten Sie auf. Das kennen wir gar nicht mehr! Deutlich und direkt werden sie. Frechheit siegt, das ist erschreckend wahr. Das sagt allerindings etwas über alle aus, aber das ist ein anderes Thema …
Jetzt sagen Sie, lieber Herr Flügge: Denen sollen wir Predigenden es – natürlich in dem Bewusstsein, auf der anderen, richtigen Seite zu stehen – in Stil und Habitus irgendwie gleichtun. „Kompromisslos“ sollen wir werden. Wir sollen predigen, dass die Kirchen wackeln. Wir sollen spaltend und aggressiv reden wie diejenigen, die damit große gesellschaftliche Aufmerksamkeit erzielen. Denn die haben beachtlichen Erfolg, bis hin zur veränderten Zusammensetzung des Bundestages. Lieber Herr Flügge, Sie haben auch ein Erfolgsversprechen für uns. Wenn wir auf unseren Kanzeln so redeten, dann würden sogar Menschen Ihrer Generation auch wieder die Kirchenbänke füllen. Oder im Internet unsere Podcasts anklicken, wenn es sie gäbe, – und es müsste sie eigentlich schon längst geben.
„Aber klüger“ sollen wir dabei sein.
Tut mir leid, das geht nicht. Ich sage nicht, dass es nicht ginge, diesen Stil zu adaptieren. Aber dabei wirklich klüger, also weiser und nicht einfach nur noch geschickter zu sein, das geht nicht.
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich Ihre berechtigten präzisen Anfragen an kirchliche Rhetorik nicht mit dem Bade ausschütte. Mit Ihren guten Überlegungen zum Zitieren, zur Bibel und zum Mut beim Predigen nicht mit dem Bade ausschütte haben Sie einiges gesagt, das trifft und öffnet. Aber in Ihrem Lob des homiletischen Populismus irren Sie. Und zwar schwer. Darin irren Sie grundsätzlich, fürchte ich. Ja, fürchte ich, gerade weil ich das Verlockende und Beflügelnde Ihrer Rede bei jedem erneuten Lesen auch wieder und wieder empfinde.
Ich sehe in den fordernden Teilen Ihres Plädoyers, mit denen Sie sich weit und mutig aus dem Fenster lehnen, ein Populismus-Bedürfnis. Dieses Bedürfnis gibt es auch unter Intellektuellen. Es hat unter eher mittig-links orientierten Menschen seine eigene Ausprägung. Auch in der Kirche gibt es das, was Sie fordern, schon längst. Nur nicht so hammermäßig, wie Sie es am 500. Jahrestag des legendären Thesenanschlages noch einmal eingefordert haben.
Wie jeder Populismus beruht auch dieser auf einer Immunisierungs-Sehnsucht, die sich mit den Stichworten „Freiheit von Angst“ und „kompromisslos“ in Ihrem Text unmissverständlich zu erkennen gibt. An dem empfindlichen Nerv unserer existentiellen Ängstlichkeit und der spiegelbildlich an den Himmel geworfenen Souveränitäts-Sehnsucht berühren sich Religion und Demagogie. An dieser intimen Stelle unserer Seele stehen die beiden ganz dicht nebeneinander. Leider halten Sie sie nicht weit genug auf Abstand. Vielmehr ermutigen Sie geradezu, das eine für das andere zu halten.
Das Menschenbild einer Predigerin, eines Predigers des Evangeliums lässt sich jedoch nicht mit dem Begriff „souveränes Ich“ betiteln, ein Ich, das rhetorisch endlich mal so richtig aufdreht. Auch eine siegreich gefeierte Programmatik von Angstlosigkeit und Radikalität würde die Verkündigungsbotschaft bis zum Bersten verbiegen, nur zu dem Zweck, dass die Predigenden und ihre Zuhörerschaften sich endlich einmal kraftvoll aufrichten könnten. Befreites, frisches Reden („παρρησία“) ist nach meiner Einschätzung etwas anderes.
Jetzt müsste eigentlich der Kronzeuge der Reformation das Wort ergreifen. Der Völkerapostel Paulus, dessen Briefe Luther & Co als Impulsgeber wiederentdeckt haben. Deren Auslegungen waren so wirkungsvoll, dass ein ganzer Kontinent in Bewegung geriet. Paulus wäre jetzt der richtige Gesprächspartner. Seine Biographie führte nämlich nicht am Beinahe-Martyrium vorbei zum religiösen Heldentum, nicht auf Sockel und unter Baldachine aus Stein, sondern in die Gefangenschaft. Von der Urchristenheit wurde er massiv beargwöhnt. Nicht nur kurz nach seiner Bekehrung war das so. Die Skepsis blieb. Sogar innerhalb der von ihm selbst gegründeten Gemeinden wurden seine Person und Botschaft frontal angezweifelt. Denn andere, viel charismatischere „Überapostel“ und strengere Moralapostel traten mitreißend in Erscheinung. Sie ließen ihn rhetorisch und persönlich als peinlich schwach da stehen. Langweilig. Für kompliziert und irreführend hielt man seine Theologie, und auch seine Briefe sind nicht volkstümlich, sondern leidenschaftlich argumentierend.“Unser geliebter Bruder Paulus“ ist schwer zu verstehen, heißt es schon im Neuen Testament (2. Petrus 3,15f). Schwere Kost. Zum Mitdenken und Nachdenken. Paulus rang mit lauter Missverständnissen, die ihm entgegengehalten wurden. Er kämpfte mit dem Wort, mit dem Argument. Udn verhehlte seine eigene Verleztbarkeit nicht. Paulus betrieb Seelsorge und Verkündigung nicht mit dem imaginären Klartext-Hammer, sondern mit dem Kreuz und mit seiner eigenen fragilen Persönlichkeit. Das Kreuz Jesu war für ihn ein Zeichen der Torheit und der Schwachheit, durch das Gott seine Kraft und Liebe zu den Entehrten, Schwachen und Todgeweihten kommen ließ.
Aber das Kreuz war nicht nur die Mitte seiner Theologie. Es war auch die Signatur seines eigenen Lebens. Ja, Paulus konnte auch beherzt „Ich“ sagen. Jeden Brief begann er mit seinem steil an den Anfang gestellten Eigennamen. Aber es war ein zitterndes Ich, das sich in Frage gestellt sah und seinen Halt immer neu ertasten und finden und herbeischreiben musste. Sein Lebenswerk blieb Fragment, von Rissen durchzogen, wie er selbst. Nicht „Ein feste Burg“, sondern die abbruchreife Hütte ist die Metapher seiner Reformation und Symbol für ihn selbst (siehe 2. Korintherbrief).
Hammer oder Kreuz, eines geht nur. Wir, die wir predigen, legen besser den Hammer aus der Hand. Auch wenn ein sympatischer und kluger Kommunikationsexperte es uns anders rät. Ich denke, uns wird vom Evangelium ein anderer Habitus nahegelegt, der sich allerdings nicht allein an Rhetorik und Rednerpose identifizieren lässt.
Ich möchte von Ihnen, lieber Herr Flügge, mit Ihrer Beobachtungsgabe und Ihrem motivierenden Charisma gerne irgendwann – vielleicht schon am 31.10.2018? – noch einmal eine ebenso leidenschaftliche Rede hören. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann uns Kanzelrednerinnen und Kanzelrednern einen Text aus dem historisch ältesten Paulusbrief neu aufschlössen. Ich für meinen Teil kann sagen: Ich ließe mir gerne darüber etwas ins Stammbuch schreiben von jemandem, der mich und meinen Berufsstand genauer beobachtet, als ich es selber kann.
„Denn ihr wisst selbst, Brüder und Schwestern, wie wir Eingang gefunden haben bei euch: Es war nicht vergeblich; sondern als wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserm Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen in hartem Kampf. Denn unsre Ermahnung kommt nicht aus betrügerischer Absicht oder unlauterem Sinn noch mit List, sondern wie Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, so reden wir, nicht, als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht – Gott ist Zeuge –, haben auch nicht Ehre gesucht von den Leuten, weder von euch noch von andern, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir waren arglos unter euch. Wie eine Amme ihre Kinder pflegt, so haben wir Herzenslust an euch und sind bereit, euch teilhaben zu lassen nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserm Leben; denn wir haben euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, an unsre Arbeit und unsre Mühe; Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben zu führen würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit.“ (aus: 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 2)
Herzlich
Werner Busch